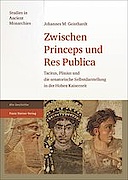Neuerscheinung: Zwischen Princeps und Res Publica. Von Johannes M. Geisthardt
19. Januar 2015
Tacitus, Plinius und die senatorische Selbstdarstellung in der Hohen Kaiserzeit
Stuttgart: Franz Steiner 2015
(Studies in Ancient Monarchies, 2)
Zitation
Nach der Schlacht von Actium entwickelte sich im Imperium Romanum der Prinzipat als neues Herrschaftssystem, das bis zur Regierung Trajans (98–117 n. Chr.) voll ausgebildet war und die Mitglieder der senatorischen Elite vor enorme Herausforderungen stellte. Denn während der permanente Konkurrenzkampf um Macht und Einfluss unter den höchsten aristokratischen Funktionsträgern des Imperiums keineswegs geringer geworden war, musste nun in allen Bereichen der Princeps als die systembeherrschende Größe stets mitberücksichtigt werden.
Insbesondere die Analyse der literarischen Selbstdarstellung der beiden Senatoren Tacitus und Plinius gibt dabei Aufschluss über mögliche Strategien, wie durch die Affirmation der trajanischen Herrschaftsdarstellung und die gleichzeitige Distanzierung die Unabhängigkeit der Senatoren weiterhin behauptet sowie die Authentizität ihrer Schriften gewahrt werden konnte. So entstehen zwischen Princeps und Res Publica zwei eindrückliche senatorische Selbstbildnisse, deren Autoren sich als selbstbewusste Systemträger zu inszenieren wissen. Literatur erscheint in diesem Kontext nicht zuletzt als ein Instrument im Konkurrenzkampf einer hochkompetitiven imperialen Elite. (Verlag)
Rezension
„Die Studie Geisthardts ist zweifelsohne ein Zugewinn für alle, die sich mit Fragen der Elitenrepräsentation und der Rolle literarischer Texte für soziale Distinktion beschäftigen. Der Autor analysiert sorgfältig, detailreich und wortgewandt.“
Laura Diegel in: H-Soz-Kult, 07.09.2015, <>http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-23447>
Dr. Johannes M. Geisthardt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Professur für Alte Geschichte (Prof. Dr. Ulrich Gotter) an der Universität Konstanz. Er war von 2008 bis 2011 als Doktorand Mitglied des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration“.